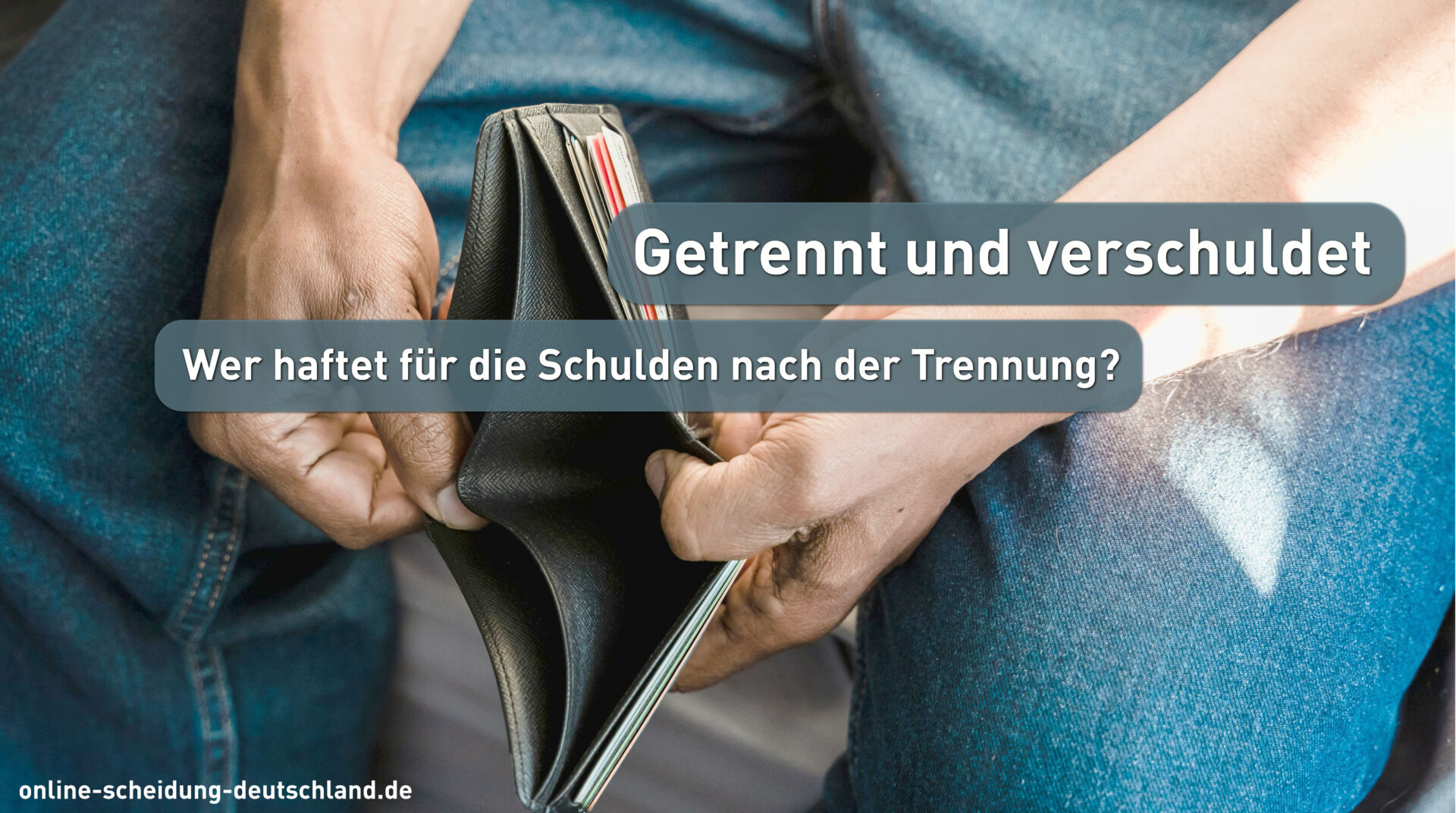
Sie stehen kurz vor der Scheidung von Ihrem Ehepartner, aber haben Angst, dass Sie aufgrund gewisser Schulden Ihres Partners finanzielle Nachteile erleiden?
Viele Menschen denken, dass bei einer Heirat die Schulden automatisch auf beiden Ehepartner gleichermaßen lasten, doch so einfach ist das nicht. Also was genau passiert mit den Schulden nach der Scheidung? Dieses und einige weitere Missverständnisse werden wir mit Ihnen in dem folgenden Beitrag aufklären.
Wer muss die Schulden zahlen?
Gemeinsame Verträge
Bei gemeinsamen Verträgen ist die Aufteilung der Schulden relativ einfach zu klären. Beispiele für häufig gemeinsam geschlossene Verträge als Ehepaar sind Miet-, Kauf-, Versicherungs- oder Kreditverträge. Viele Anschaffungen für den gemeinsamen Lebensbedarf oder auch die Finanzierung der Hochzeit werden grundsätzlich auch als gemeinsame Schulden angesehen. Diese Anschaffungen werden als Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs gemäß § 1357 BGB gewertet. Hierbei entfalten die Schulden Wirkung auf beide, obwohl der Vertrag lediglich mit einem Ehepartner geschlossen wird. Dementsprechend muss nicht jeder gemeinsame Vertrag von beiden unterzeichnet werden.
Die beiden Ehepartner haften dann gemeinsam gegenüber dem Gläubiger (gesamtschuldnerische Haftung, § 421 BGB). Dieser kann entscheiden, von wem er die Zahlung verlangt. Logischerweise entfällt der Anspruch, sobald einer die Schulden begleicht.
Derjenige kann daraufhin vom ehemaligen Ehepartner eine Ausgleichszahlung in Höhe der Hälfte der Gesamtsumme einfordern.
Ein Ehepartner hat Schulden
Im Gegensatz zu den gemeinsamen Verträgen ist ein Ehepartner nach der alleinigen Abschließung eines Vertrags für die daraus entstehenden Schulden selbst verantwortlich. Häufig kommt jedoch die eben angesprochene Ausnahme des § 1357 BGB in Betracht. Im Rahmen eines Ehevertrages kann zuvor jedoch geregelt worden sein, inwiefern die Schulden des Einzelnen auch den anderen Partner betreffen.
Sonderfall: Bürgschaft für den Ehepartner
Ein typischer Sonderfall ist, dass ein Ehepartner die Bürgschaft für den Partner unterschreibt. Also er verpflichtet sich für die Verbindlichkeiten des Ehepartners gegenüber dessen Gläubiger einzustehen. Besonders nach einer Scheidung kann das zu gewissen Problemen führen. Beispielsweise kann sich die Bank direkt an den bürgenden Ehepartner wenden, wenn der kreditnehmende Ehepartner seine Zahlungen nicht begleicht. Diese Schulden wurden sozusagen von dem einen Vertragspartner verursacht, aber müssten vom anderen ausgeglichen werden.
Es kann jedoch auch sein, dass der Bürgschaftsvertrag aufgrund von Sittenwidrigkeit erfolgreich angefochten wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied in der Vergangenheit schon gegen die Gültigkeit eines derartigen Vertrages aufgrund einer finanziellen Überforderung des bürgenden Ehepartners.
Der Güterstand – welche Rolle spielt er?
Heutzutage gibt es grundsätzlich drei Varianten beim Güterstand. Der Normalfall ist die Zugewinngemeinschaft, in der beide Partner sich gleichermaßen an dem Vermögensaufbau beteiligen. Unabhängig vom Einkommen erwirtschaften beide somit gemeinsam den Zugewinn während der Ehe. Anders als die Zugewinn-Beträge werden die Schulden jedoch auch bei diesem Güterstand nicht aufgeteilt.
Die zweite Variante ist die Gütertrennung, welche vor allem für Vollverdiener eine Rolle spielt. Hierbei behalten beide Ehepartner ihre Selbstständigkeit in der Erwirtschaftung bei. Das Besondere ist, dass nicht nur die Schulden, sondern auch die Zugewinne nach einer Scheidung nicht aufgeteilt werden. Auch für den Todesfall müsste ein Testament bestehen, damit der verbliebene Ehepartner einen Zugewinnausgleich bekommt.
Die dritte und letzte Variante kommt heutzutage nur noch selten vor. Bei der Gütergemeinschaft wird das Vermögen vollständig zusammengelegt. Anders als bei der Zugewinngemeinschaft wird hier auch das vor der Ehe erwirtschaftete gemeinsam verwaltet. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass beide Ehepartner grundsätzlich in vollem Umfang für die gemeinsam aufgenommenen Schulden haften.
Fragen zum Thema: Schulden nach der Scheidung
Frage: Kann man gemeinsame Schulden vor der Ehe verhindern?
Antwort: Ja, zum Beispiel mit einem Ehevertrag, dem Vermeiden von Bürgschaften oder auch getrennten Konten. In dem Ehevertrag kann festgehalten werden, wer für welche finanziellen Verpflichtungen haftet und wie gemeinsame Schulden aufgeteilt werden.
Frage: Hafte ich mit, wenn mein Partner Insolvenz anmeldet?
Antwort: Nein, grundsätzlich nicht, auch nicht bei einer Privatinsolvenz meines Partners. Eine Mithaftung gibt es nur, wenn dies vertraglich geregelt wurde.
Frage: Wie lange hafte ich für gemeinsame Schulden nach der Trennung?
Antwort: Bis die Schulden beglichen wurden (zeitlich unbegrenzt). Die rechtliche Bindung der Zahlung an den Gläubiger verfällt nicht durch eine Scheidung.
Frage: Kann ich aus einem gemeinsamen Kreditvertrag aussteigen (während der Trennung)?
Antwort: Nur, wenn die Bank (das Kreditinstitut) dem Austritt zustimmt. Stattdessen kann es zu einer Veränderung im Innenverhältnis zwischen den Partnern kommen. Bei dieser internen Vereinbarung kann entschieden werden, wer welche Raten abzahlen muss.
Frage: Muss ich für neue Schulden, welche mein Ex-Partner während der Trennung macht, mithaften?
Antwort: Grundsätzlich haftet man für diese neuen Schulden nicht, sondern nur wenn sie zur Deckung des gemeinsamen Lebensbedarfs zählen, was nach der Trennung in der Regel nicht der Fall ist (§ 1357 BGB).
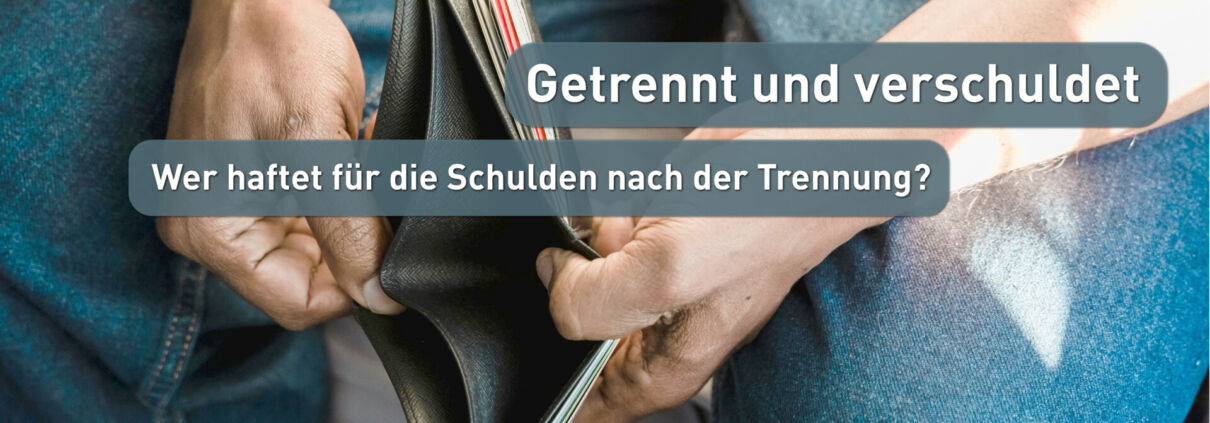
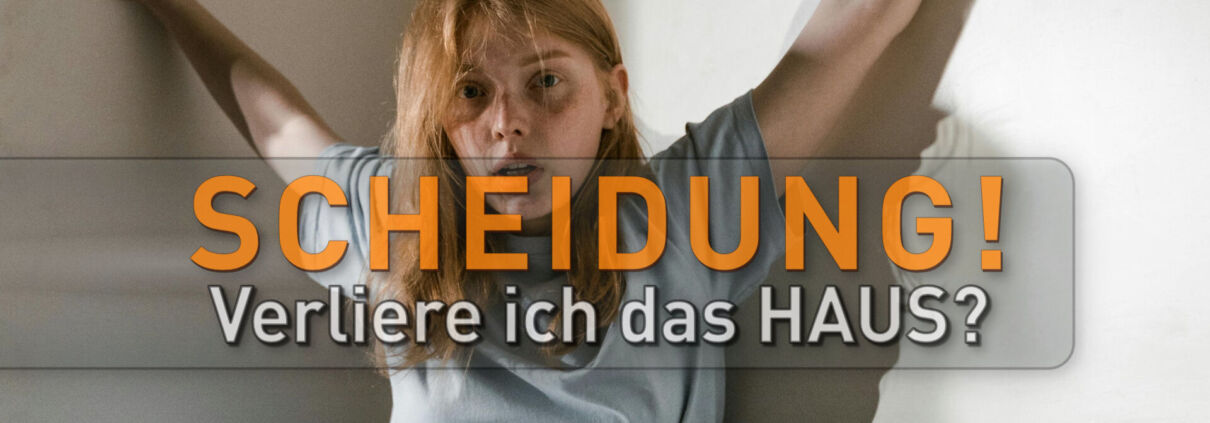
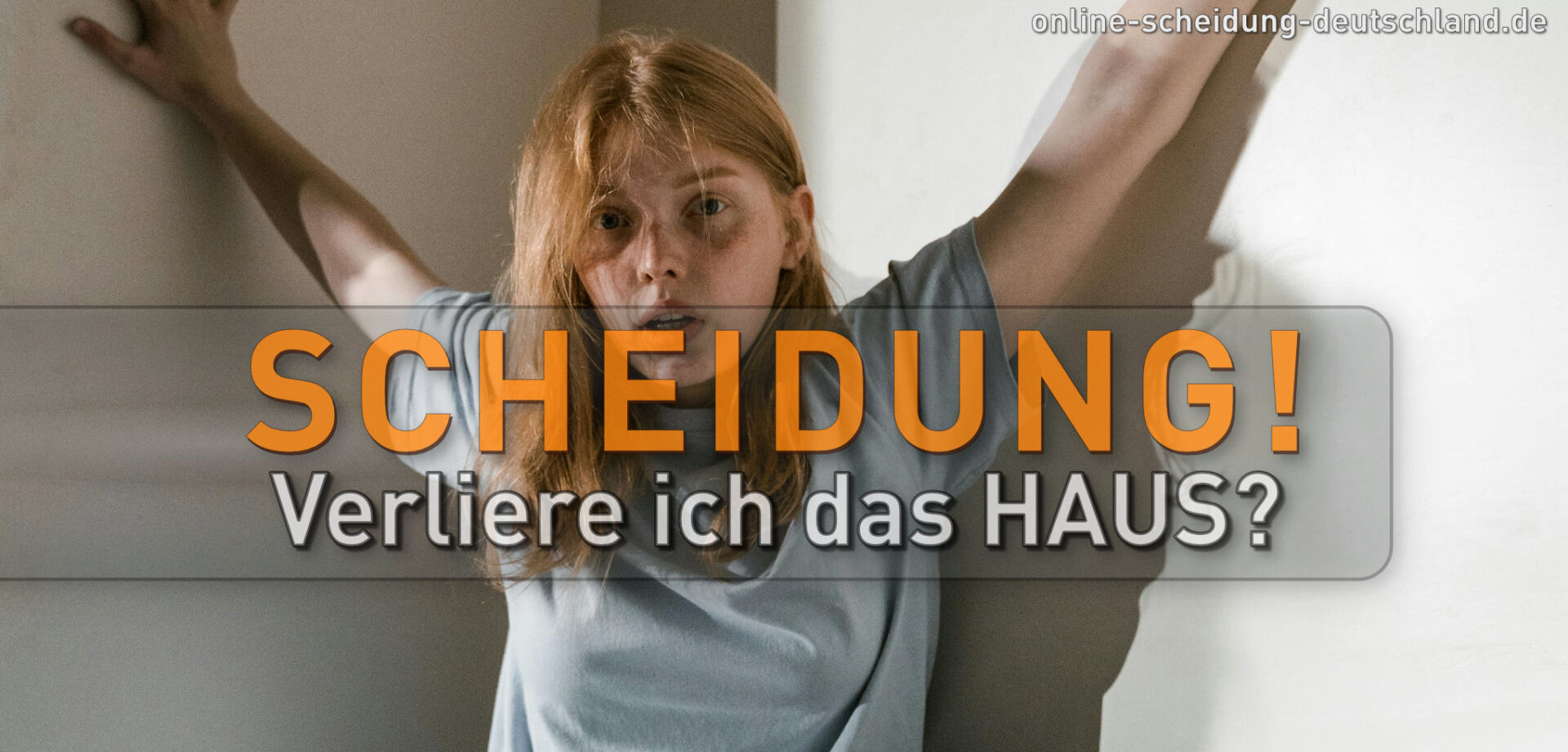

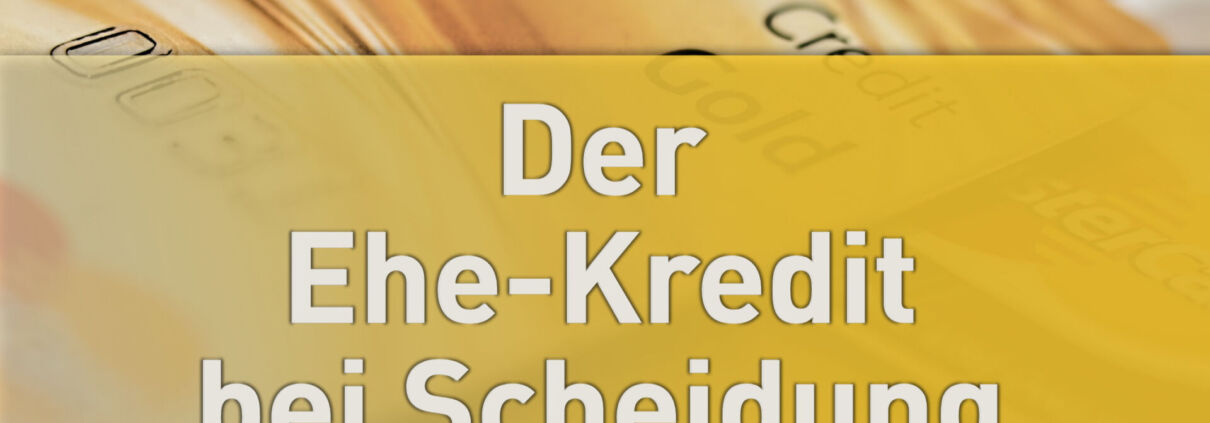
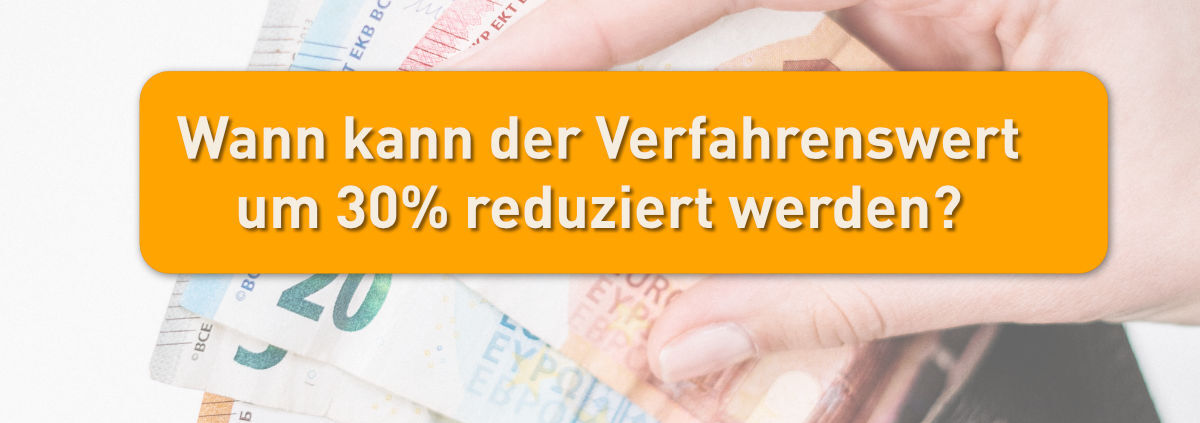





 Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen:
Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen: