 Viele stellen sich nach der Scheidung die Frage, ob man seinen Ex-Partner nun Unterhalt zahlen muss. Generell gibt es viele Unklarheiten und Mythen über den sogenannten Ehegattenunterhalt. Deswegen versuchen wir im Folgenden einige dieser Fragen aufzuklären. Genauer gesagt kann gemäß § 1570 BGB ein geschiedener Ehegatte von dem Ex-Partner mindestens drei Jahre nach der Geburt noch Unterhalt für das gemeinsame Kind verlangen. Doch wovon hängt die Dauer dieses Anspruches ab? Und wodurch genau verlängert er sich?
Viele stellen sich nach der Scheidung die Frage, ob man seinen Ex-Partner nun Unterhalt zahlen muss. Generell gibt es viele Unklarheiten und Mythen über den sogenannten Ehegattenunterhalt. Deswegen versuchen wir im Folgenden einige dieser Fragen aufzuklären. Genauer gesagt kann gemäß § 1570 BGB ein geschiedener Ehegatte von dem Ex-Partner mindestens drei Jahre nach der Geburt noch Unterhalt für das gemeinsame Kind verlangen. Doch wovon hängt die Dauer dieses Anspruches ab? Und wodurch genau verlängert er sich?
Arten des Ehegattenunterhalts – Welche Unterschiede gibt es?
Zunächst ist wichtig zu sagen, dass im deutschen Rechtssystem zum einen der Trennungsunterhalt nach § 1361 BGB und zum anderen der nacheheliche Unterhalt nach § 1569 BGB existiert.
Der Trennungsunterhalt dient der Aufrechterhaltung der vorherigen Lebensverhältnisse der geschiedenen Partner. Anders als beim Kinderunterhalt dient er der Versorgung des Elternteils. Durch ihn wird ein finanzielles Gleichgewicht nach der Beendigung der wirtschaftlichen Lebensgemeinschaft bis zur endgültigen Scheidung geschaffen. Durchschnittlich dauert das zwischen drei und zehn Monaten, kann allerdings durch eine strittige Scheidung auch noch deutlich länger werden.
Der nacheheliche Unterhalt, um welchen es im folgenden Text geht, ist ebenso für ein finanzielles Gleichgewicht da. Jedoch beginnt dieser zeitlich erst nach der rechtlichen Scheidung und bezieht sich auf die derzeitig vorliegenden Lebensverhältnisse der Betroffenen.
Was sind die Voraussetzungen der §§ 1569 ff. BGB? – Wer hat Anspruch?
Für einen Anspruch auf den nachehelichen Unterhalt müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt worden sein. Zunächst muss eine rechtskräftige Scheidung der Ehepartner vorliegen. Damit ist gemeint, dass die Scheidung bereits endgültig bindend ist und nicht mehr von einer der Parteien angefochten werden kann. Des Weiteren muss der Anspruchsinhaber bedürftig sein. Das ist der Fall, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht mehr selbstständig aufrechterhalten kann und auf die Zahlung des Ex-Partners sozusagen angewiesen ist. Dementsprechend muss dieser Ex-Partner jedoch auch in der Lage sein, diese zusätzlichen Kosten seinerseits zu tragen. Schlussfolgernd zahlt die Person mit einem höheren bereinigten Nettoeinkommen.
Eine weitere Voraussetzung ist das Vorliegen einer der sieben gesetzlichen Unterhaltstatbestände der §§ 1570 ff. BGB. Ein paar Beispieltatbestände sind der Unterhalt wegen Alters (§ 1571 BGB), der Unterhalt wegen Krankheit (§ 1572 BGB) oder der Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 Abs. 1 BGB).
Als Letztes kann der Anspruch auch verwirkt sein. Der Unterhaltsberechtigte darf den Umgang mit dem gemeinsamen Kind gegenüber den Zahlungspflichtigen nicht stark behindern. Dieses Fehlverhalten muss für eine Verwirkung laut dem OLG München eindeutig beim Anspruchsinhaber liegen. Schlussfolgernd kriegt der geschiedene Partner den nachehelichen Unterhalt, wenn all die soeben genannten Voraussetzungen vorliegen und der Anspruch nicht verwirkt ist.
Dauer des Ehegattenunterhalts
Die angesprochene Unterhaltspflicht von drei Jahren aus § 1570 BGB kann, soweit es der Billigkeit entspricht, verlängert werden. Hierbei zählt insbesondere die Betrachtung des Einzelfalls und ob die Betreuung des Kindes nicht anders gewährleistet werden kann. Ein Kind ist dann schließlich immer noch betreuungsbedürftig. Lediglich die Vollzeitbetreuung wird vom Gesetzgeber ab der Vollendung des 3. Lebensjahres nicht mehr als unbedingt notwendig angesehen. Ein Beispiel für einen Billigkeitsgrund ist ein fehlender Kindergartenplatz, wodurch die Mutter eine Teilzeitstelle auf ihrer Arbeit nicht belegen konnte. Ebenfalls die gesundheitliche Beeinträchtigung eines Kindes oder auch die Betreuung mehrerer Kinder mit engem Altersabstand zählen als Billigkeitsgrund.
Zudem kann es sein, dass eine Fremdbetreuung aufgrund fehlender Kindergärten oder Kindertagesstätten nicht möglich erscheint. Dieser Punkt findet häufiger in ländlicheren Regionen Anwendung.
Gemäß § 1578 b BGB kann dieser Anspruch zeitlich begrenzt oder herabgesetzt werden. Eine Herabsetzung spricht von der Reduzierung der Kosten und die Befristung von der Beendigung des Anspruches zu einem bestimmten Zeitpunkt. Insbesondere bei keinen oder geringen Nachteilen für den Anspruchsberechtigten wird der Unterhaltsanspruch beschränkt. Beispiele wären eine kurze Ehe, eine neue wirtschaftliche Situation, oder die vollständige Erwerbsfähigkeit des Betreuenden. Hier wird die Entscheidung wiedermal je nach Einzelfall abgewogen.
Generell sollen die §§ 1578b, 1579 BGB für mehr Einzelfallgerechtigkeit sorgen.
Erwerbsobliegenheit – Muss der Partner arbeiten?
Gemäß § 1574 BGB liegt eine Obliegenheitspflicht für eine Erwerbstätigkeit für den geschiedenen Ehegatten vor. Die Erwerbstätigkeit muss dem Prinzip der Angemessenheit entsprechen, welches laut dem Gesetzgeber von 5 persönlichen Merkmalen abhängig gemacht wird.
Bedeutend sind:
- die Ausbildung,
- die Fähigkeiten (bspw. besonderer Führerschein o. Fremdsprachenkenntnisse),
- die frühere Erwerbstätigkeit,
- das Lebensalter &
- der Gesundheitszustand
Solange keine besonderen Gründe vorliegen, müssen die Geschiedenen sich dementsprechend um eine Erwerbstätigkeit kümmern. Bei der Möglichkeit für verschiedene Tätigkeiten besteht ein Wahlrecht. Wenn der Unterhaltsberechtigte dieser Pflicht nicht nach geht, kann es zu einer Kürzung oder vollständigen Aussetzung des Ehegattenunterhalts führen.
Wie wird der Ehegattenunterhalt berechnet?
Der Ehegattenunterhalt berechnet sich nach der Differenz der bereinigten Nettoeinkommen der ehemaligen Ehepartner. Von dieser Differenz müssen ungefähr 45% (3/7) vom Unterhaltspflichtigen bezahlt werden.
Beispiel
Person 1, Nettoeinkommen von 5.500€
Person 2, Nettoeinkommen von 2.500€
-> die Differenz beträgt 3.000€
-> 3.000 x 0,45 = 1.350
Ergebnis: Die 1. Person hat der 2. Person 1.350€ Ehegattenunterhalt zu zahlen.
Zunächst ist jedoch bei gemeinsamen Kindern immer der Kinderunterhalt zu beachten. Dieser wird mit dem Trennungsunterhalt verrechnet.
Wie genau der Kindesunterhalt berechnet wird, finden Sie hier !
Auswirkung einer neuen Partnerschaft o. Heirat
Eine neue Heirat des Unterhaltspflichtigen verändert voraussichtlich nichts an der Zahlung des Ehegattenunterhalts. Dieser Anspruch bleibt dann weiterhin bestehen. Wenn jedoch der Unterhaltsberechtigte eine neue Ehe eingeht, dann führt das meistens zu einem Untergang des Unterhaltsanspruches. Ebenfalls eine eheähnliche Lebensgemeinschaft könnte eine Beendigung der Zahlungspflicht für den Ex-Partner bedeuten.



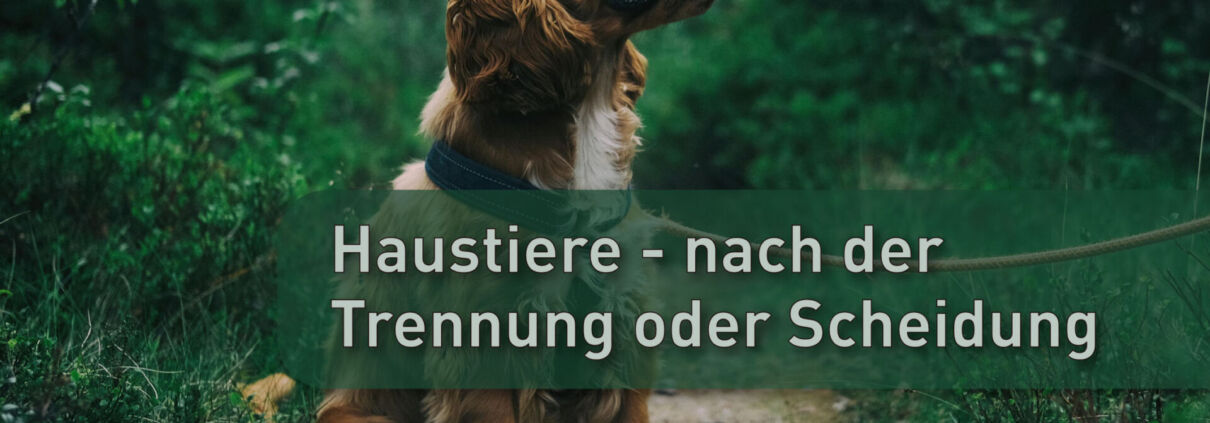
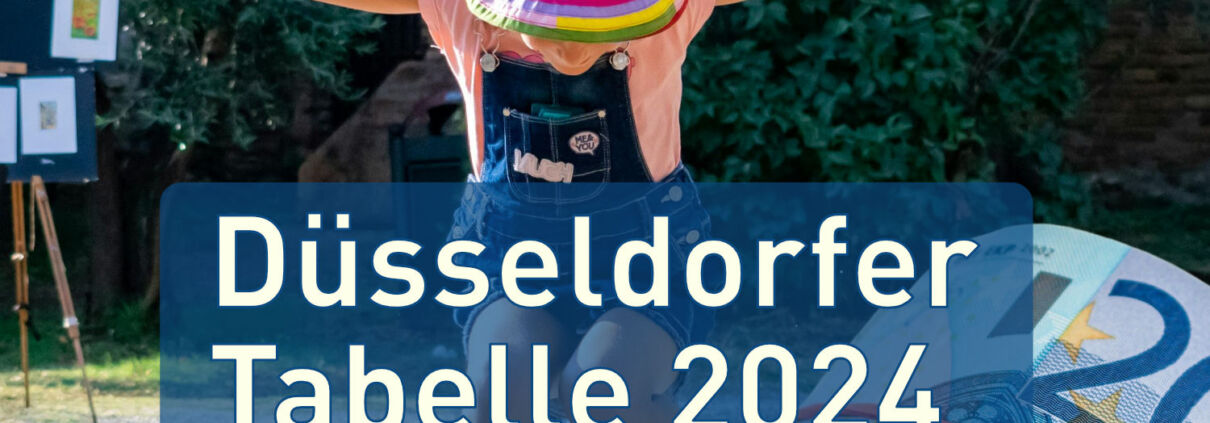


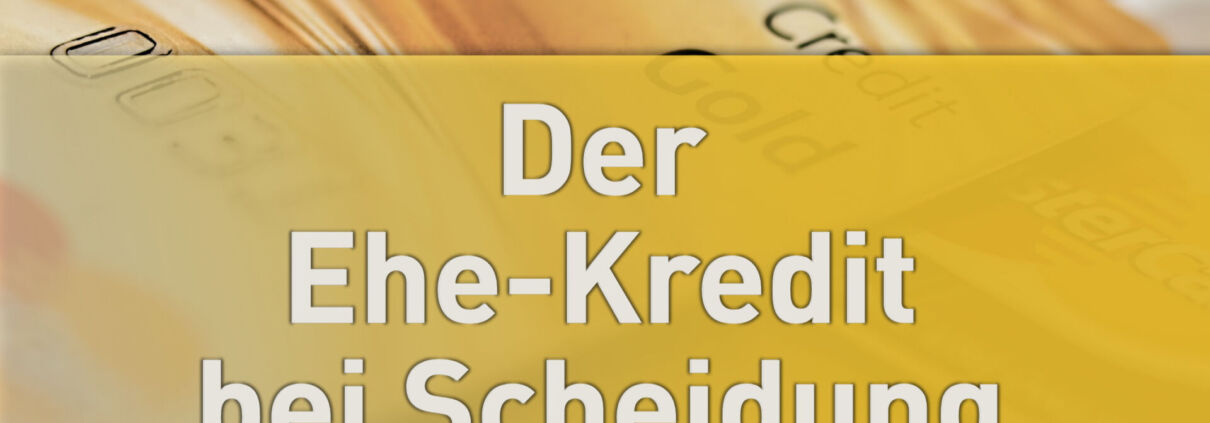
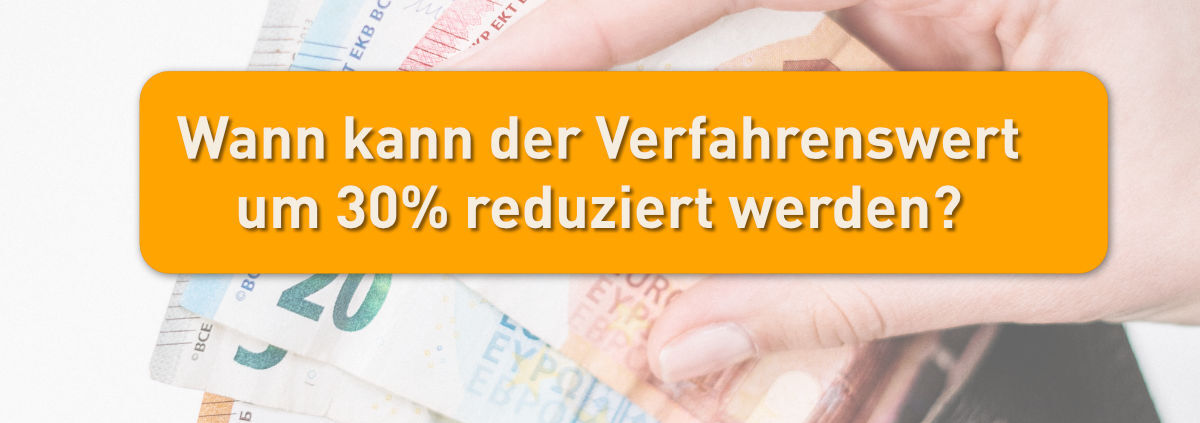

 Ehepartner verschwunden – Scheidung unmöglich?
Ehepartner verschwunden – Scheidung unmöglich?




 Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen:
Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen: